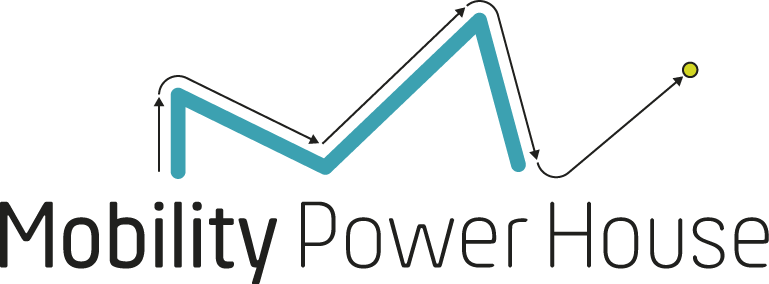INTERVIEW : STEPHAN BURGDORFF.
Herr Müller, Sie bezeichnen sich als Experte für „disruptive Mobilität“. Was versteht man unter diesem Begriff?
Mein Unternehmen versteht darunter alles, was nicht das traditionelle Feld der Automobilhersteller betrifft. Deren Geschäfts-modell beruhte bisher auf dem Prinzip: Ein Kunde – ein Auto. Diese Gleichung geht heute aber nicht mehr auf. Vielen Menschen reicht es, mobil zu sein, wenn sie Mobilität auch wirklich brauchen. Das steht im Gegensatz zu dem klassischen Modell: Man hat ein Auto, aber benutzt es maximal eine Stunde am Tag.
Was bedeutet es für die Automobilhersteller, wenn dieses klassische Modell aufgebrochen wird?
Ihr Geschäftsmodell muss sich wandeln. Am deutlichsten zeigt sich das bei der Elektromobilität. Wer hätte gedacht, dass die Unternehmen sich so schnell darauf ein-stellen müssen. Genau das Gleiche passiert beim Thema „neue Mobilität“. Gerade jüngere Menschen wenden sich vom Auto ab. Sie teilen sich lieber ein Auto mit ande-ren als Wert auf ein eigenes Fahrzeug zu legen.
Das heißt, die Nutzung eines Autos muss nicht mehr mit seinem Besitz verbunden sein?
Genauso ist es. Nutzung und Besitz werden entkoppelt. Man hat jetzt die Möglichkeit zum Beispiel durch Carsharing, ein Auto zu nutzen und es irgendwo abzustellen, wenn man es nicht mehr braucht. Das eigene Auto wird überflüssig, der Nutzer spart Anschaf-fungskosten, Reparaturen, Versicherung und Steuern. So ein Geschäftsmodell ist aber auch für die Autohersteller attraktiv, weil sie zum einen auf diese Weise junge Kun-den für ihre Marke interessieren und zum anderen Geld als Carsharing-Anbieter ver-dienen können.
Carsharing lässt sich in großen Städten gut organisieren, wo viele Menschen dicht beieinander wohnen. Aber wie sieht es damit auf dem dünn besiedelten Land aus?
Sowohl Carsharing als auch andere „on demand“ Mobilitätsdienstleistungen, wie Fahrdienste, können derzeit nur in urbanen Ballungsräumen wirtschaftlich betrieben wer-den. In ländlichen Gebieten oder kleinen Städten ist das nicht möglich. Jedenfalls dann nicht, wenn das Carsharing-Unternehmen eigene Autos zur Verfügung stellt. Selbst in Deutschland kommen dann nur drei Städte in Frage: Berlin, Hamburg und München. Wenn allerdings ein Vermittler antritt, der keine eigenen Autos besitzt und nur eine Vermittlungsgebühr für Taxidienste kassiert, kann eine sol-che Dienstleistung unter Umständen auch in kleineren Städten profitabel sein.
Gehört zur neuen Mobilität nur die Nutzung des Autos von mehreren Personen oder auch eine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern?
Je größer der Markt wird, desto mehr Vari-anten bilden sich heraus. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass der Volkswagen Konzern zusammen mit der Stadt Hamburg überlegt, wie man den Kunden auf der sogenannten „letzten Meile“ zu seinem Ziel bringen kann. Das wird nur möglich sein durch Partnerschaf-ten verschiedener Verkehrsträger, die das eigene Angebot ergänzen.
Sie plädieren also für Zusammenarbeit von privaten Unternehmen und dem öffentlichen Nahverkehr?
Der öffentliche Nahverkehr hat leider das Problem jedes Monopolisten. Er hat sich zu lange ausgeruht auf dem was er hat – sicher auch, weil die Kommunen ihn nicht mit genügend Geld ausgestattet haben, um sein Ange-bot auszubauen. Unternehmen wie Volks-wagen oder Daimler sind nun dabei, gemeinsam mit den Kommunen Konzepte zu entwickeln, die nicht nur den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, sondern von denen sie auch selber profitieren.
Inwiefern profitieren die Automobilhersteller von dieser Kooperation?
Zum einen lässt sich mit dem zusätzlichen Service die Wertschöpfung vertiefen. Zum anderen zeigt man dem Kunden, dass man innovativ ist und ihn nicht allein lässt. Egal wo er ist, er kann sich darauf verlassen, dass immer ein Produkt zum Beispiel von Volks-wagen zur Verfügung steht. Und noch etwas kommt hinzu: An diesem Geschäft sind auch viele andere Unternehmen interessiert, die eigentlich mit Autos gar nichts zu tun haben. Nämlich Google, Apple, Baidu, Alibaba und andere große Technologiekonzerne.
Was ist deren Interesse?
Die riesige Menge an Daten, die bei diesem Service anfällt. Denn deren Besitz könnte dazu führen, dass ein Automobilhersteller nur noch Zulieferer für den Technologieko-nzern ist, der den Zugang zu den Kunden hat. Das ist für Automobilunternehmen ein Horrorszenario, weil sie ja von der Kunden-bindung leben. Sie sind also gut beraten, bei der Gestaltung der neuen Mobilität eine zentrale Rolle einzunehmen.
Was müssen die Städte tun, damit die Nutzerzahlen des Carsharing weiter steigen?
Ein gutes Beispiel ist Madrid. Dort ist das Carsharing so populär, dass inzwischen drei Anbieter mit jeweils mehr als 500 Elektroautos im Markt sind. Der Grund ist, dass alle Elektroautos oder auch Hybridfahrzeuge überall in der Stadt umsonst geparkt wer-den dürfen – unabhängig davon ob man Anwohner ist oder nicht. Es kommt also dar-auf an, dass die Kommunen das Thema aktiv angehen. Und das ist auch ganz leicht möglich. Denn es kostet sie ja nichts.